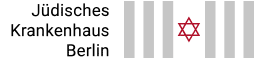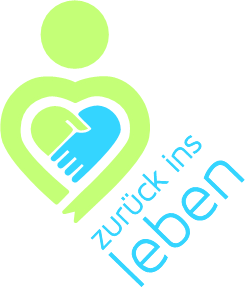Medizin am Abend Berlin Fazit:
Das Risiko, an einer Herzkrankheit zu versterben, ist in Deutschland
geografisch sehr ungleich verteilt, zeigt der gestern in Berlin
vorgestellte aktuelle Deutsche Herzbericht.
Im Ländervergleich der
Sterbeziffern haben die östlichen Bundesländer die höchsten Werte.
An
einer der häufigsten Herzkrankheiten
(ischämische, also durch
Minderdurchblutung hervorgerufene Herzkrankheiten,
Herzklappenkrankheiten, Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz)
verstarben im Jahr 2013 in Sachsen-Anhalt 389 von 100.000 Bewohnern, in
Sachsen 360, in Thüringen 335 und in Mecklenburg-Vorpommern 319. Am
anderen Ende der Skala befinden sich Berlin mit einer Sterbeziffer von
193, Hamburg mit 214 und Baden Württemberg mit 225.
„Die aus früheren Herzberichten bereits bekannten Unterschiede zwischen
den Bundesländern bleiben insgesamt bestehen“, kommentiert DGK-Präsident
Prof. Dr. Karl-Heinz Kuck (Hamburg) die aktuellen Zahlen.
„Die höchste
Sterbeziffer eines Landes bei den ischämischen Herzkrankheiten kann die
niedrigste Sterbeziffer um mehr als das Doppelte übersteigen.
Gleiches
gilt bei den Herzklappenkrankheiten und bei den Herzrhythmusstörungen.
Noch größer fallen die Unterschiede bei der Herzinsuffizienz aus.
Ischämische Herzkrankheit und Herzinsuffizienz haben dabei in allen
Bundesländern einen dominierenden Einfluss auf die Sterblichkeit.“
Sehr unterschiedlich präsentiert sich auch die regionale Verteilung bei
der Herzinfarkt-Sterblichkeit (akuter Myokardinfarkt). In Sachsen-Anhalt
betrug hier die Sterbeziffer 99, in Brandenburg 98, in Bremen 94 und in
Sachsen 93, am anderen Ende der Skala befinden sich Schleswig-Holstein
mit 43, Berlin und Hamburg mit 48.
- Überraschend ist die starke Zunahme der Sterblichkeit in Bremen
innerhalb eines Jahres von 70 auf 94.
Zu bedenken sei, dass es in den
vergangenen Jahren in diesem Stadtstaat immer wieder starke Schwankungen
der Zahlen gegeben hat, heißt es dazu im Herzbericht. Da die dort
erhobenen Zahlen klein sind, können sich kleinere Veränderungen schnell
auf das Gesamtergebnis auswirken. Bei den Stadtstaaten könne es auch
deshalb zu statistischen Verzerrungen der Sterbeziffern kommen, weil
hier viele Patienten aus den umliegenden Bundesländern mitversorgt
werden.
„Die Unterschiede der Sterbezahlen zwischen den Bundesländern sind auf
unterschiedliche Faktoren zurückzuführen,
zum Beispiel die
Altersktur, den sozioökonomischen Status der Bevölkerung, das
jeweilige Gesundheitsbewusstsein, die Ärztedichte oder das regionalstrue
diagnostische und therapeutische Angebot“, so Prof. Kuck.
„Aus
gesundheitlicher und gesundheitspolitischer Sicht muss es darum gehen,
durch geeignete Maßnahmen die Situation in den Ländern mit hoher
Sterbeziffer konsequent an jene der am besten abschneidenden Länder
heranzuführen.“
Der gestern in Berlin vorgestellte aktuelle „Deutsche Herzbericht“
dokumentiert mit aktuellen Zahlen die beeindruckenden Fortschritte der
deutschen Herz-Medizin und deren praktische Auswirkungen für
Herz-Patienten.
„Verstarben im Jahr 1990 in Deutschland insgesamt noch
324,8 Einwohner pro 100.000 an den häufigsten Herzkrankheiten, ging die
Sterbeziffer bis zum Jahr 2013 um 17,2 Prozent auf 268,9 zurück“,
berichtet Prof. Dr. Karl-Heinz Kuck (Hamburg), Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie (DGK) auf einer Pressekonferenz.
Im Detail
verringerte sich zwischen den Jahren 1990 und 2013 die Sterbeziffer in
der großen Gruppe der ischämischen, durch Minderdurchblutung bewirkten
Herzkrankheiten von 216,3 auf 159,5, bei der Herzschwäche
(Herzinsuffizienz) von 82,0 auf 56,7, und bei angeborenen Herzfehlern
von 1,5 auf 0,6.
Gegenläufiger Trend bei Herzklappenkrankheiten und Herzrhythmusstörungen
- Bei zwei Gruppen von Herz-Krankheiten ist der Trend allerdings
gegenläufig: So stieg zwischen 1990 und 2013 die Sterbeziffer bei
Herzklappenkrankheiten von 7,8 auf 19,7 und bei Herzrhythmusstörungen
von 17,1 auf 32,4 an.
„Diese Entwicklungen sind zum Teil eine Konsequenz
der Fortschritte in der modernen Herz-Medizin mit dadurch
geänderter
Wahrnehmung, die sich in der Zuordnung der Diagnosen auf den
Totenscheinen widerspiegelt“, erklärt Prof. Kuck.
- „Heute überleben
allerdings auch immer mehr Patienten einen akuten Herzinfarkt, erkranken
aber später an anderen Herzkrankheiten. Dieser Trend ist damit auch
Ausdruck der zunehmenden Lebenserwartung, wobei zum Beispiel das Risiko
für Herzklappen- oder Herzrhythmuserkrankungen mit zunehmendem Alter
überproportional ansteigt.“
Herzkrankheiten summierten sich auf 1.595.312 bzw. 8,3 Prozent aller
2013 im Rahmen der Krankenhausdiagnose-Statistik erfassten 19.249.313
vollstationären Fälle. Insgesamt sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen für
zwei Drittel aller Todesfälle in Deutschland verantwortlich und somit
unverändert die Todesursache Nummer 1.
- Die drei Krankheitsgruppen
chronische ischämische Herzkrankheit, akuter Herzinfarkt und
Herzinsuffizienz machten knapp die Hälfte der zehn häufigsten
Todesursachen aus.
Dauerhaft positive Entwicklung beim Herzinfarkt
Am akuten Herzinfarkt verstarben 2013 in Deutschland 64,4 von 100.000
Einwohnern, das ist gegenüber dem Jahr 1990 ein Rückgang von rund 40
Prozent:
42,2 Prozent bei Männern und 37,2 Prozent bei Frauen. Nach
einem geringfügigen Anstieg im Jahr 2012, der vorrangig durch die
Umstellung der Berechnungsgrundlage aufgrund des Zensus 2011 verursacht
war, hat sich 2013 der generelle Abwärtstrend fortgesetzt.
„Es ist davon
auszugehen, dass die Verringerung der Sterbeziffer beim akuten
Herzinfarkt
neben dem Rückgang der Anzahl von Rauchern auch auf
Verbesserungen der strukturellen und therapeutischen Maßnahmen
zurückzuführen ist“, so Prof. Kuck.
„Allen voran ist hier die
flächendeckende Herzkatheter-Therapie zu nennen, die eine
interventionelle Wiedereröffnung der verschlossenen Blutgefäße mittels
Notfall-Kathetereingriff ermöglicht.
- Außerdem wurde die Zeit im
Rettungswagen vor dem Erreichen des Krankenhauses verkürzt, das
Notarztsystem ausgebaut und die ‚Pforte-Ballon-Zeit‘ im Krankenhaus
reduziert.
- Auch der Einsatz von Stents zum Offenhalten verengter oder
verschlossener Blutgefäße, eine optimierte Thrombolyse
(Blutgerinnsel-Auflösung) und eine immer bessere medikamentöse
Begleittherapie spielen hier eine wichtige Rolle.“
Herzkatheter: Hohes Versorgungsniveau mit guter Qualität
Einen weiterhin steigenden Trend verzeichnet der neue Herzbericht beim
Einsatz von Herzkathetern f
ür diagnostische und therapeutische Zwecke:
Zwischen 2013 und 2014 stieg die Zahl der diagnostischen
Linksherzkatheter-Untersuchungen, auf das Bundesgebiet hochgerechnet,
von 885.131 auf 906.843 an, die Zahl
der Perkutanen
Katheterinterventionen (PCI) von 342.749 auf 361.377.
Vom AQUA Institut (Institut für angewandte Qualitätsförderung und
Forschung im Gesundheitswesen GmbH) erhobene Daten zeigen,
dass
bezüglich der Indikation zur Herzkatheter-Untersuchung in sehr hohem Maß
den gültigen Leitlinien entsprechend vorgegangen wurde.
In über
93
Prozent aller Untersuchungen (2013) gibt es demnach
die geforderten
klinischen Symptome oder den Nachweis einer Ischämie
(Minderdurchblutung).
Für die meisten Herzinfarkt-Patienten ist eine
Herzkatheterintervention die optimale und oft lebensrettende Behandlung.
Prof. Kuck:
„Anhand der aktuellen Zahlen lässt sich weder eine Über-
noch eine Fehlverordnung feststellen. Beim Blick auf die
Gesamtentwicklung und die Behandlungsresultate steht Deutschland im
internationalen Vergleich besser da als andere Länder.“
- Steigend ist auch die Zahl implantierter Stents zum Offenhalten von
Blutgefäßen: Hochgerechnet erhöhte sich ihre Zahl auf 323.828 Fälle
(2014) gegenüber 300.740 im Jahre davor.
Aufgrund der Bevölkerungsstruktur und von
Mehrfacherkrankungen
(Multimorbidität) im Alter ist zu erwarten, dass die Katheter-Zahlen
2016 auf dem bestehenden hohen Niveau bleiben.
„Kritisch gesehen wird
die Frage, ob in Zukunft nicht viele elektive (Anm.: nicht unmittelbar
erforderliche) Katheter-Untersuchungen durch nicht-invasive Verfahren
wie Computertomografie (CT) und Magnetresonanztomografie (MRT) ersetzt
werden können“, so Prof. Kuck.
„Dazu fehlen allerdings in Deutschland
bisher adäquate Rahmenbedingungen zum Beispiel bei der Spezialisierung
und in der Vergütung und geeignete klinische Studien.“
Verbesserte Therapien von Herzrhythmusstörungen
Herzrhythmusstörungen gehören heute zu den häufigsten Herzkrankheiten,
in den Sterblichkeits- und Häufigkeitsstatistiken ist bei ihnen in den
vergangenen Jahren ein Anstieg zu verzeichnen. Die Zahl der
vollstationär behandelten Fälle pro 100.000 Einwohner ist zwischen 2008
und 2013 um 23,3 Prozent angestiegen.
- „Die Ursache dieses Anstiegs kann
unter anderem in der verbesserten Diagnostik der Herzrhythmusstörungen
gesucht werden, aber auch in der Alterung des
Bevölkerungsdurchschnitts“, so Prof. Kuck.
„Im gleichen Zeitraum haben
sich die medikamentösen, chirurgischen, interventionellen und
invasiv-ablativen Behandlungsmöglichkeiten verbessert.“
- Nach einer
Hochrechnung wurden 2014 in Deutschland 58.374 elektrophysiologische
Untersuchungen vorgenommen, um 13 Prozent mehr als im Jahr davor.
Die
Zahl der Katheter-gestützten Ablationen von Herzrhythmusstörungen war
mit 69.052 um 11,5 Prozent höher als im Jahr davor.
Implantation von Herzschrittmachern und Kardioverter-Defibrillatoren (ICD)
Im Jahr 2014 wurden in Deutschland im Rahmen der stationären Versorgung
von Patienten insgesamt 156.870 Operationen bei
kardialen
Rhythmusimplantaten durchgeführt, 108.193
Schrittmacher-Implantationen
und 58.677
Implantationen von Kardioverter-Defibrillatoren (ICD).
- Das
waren knapp 3.000 Eingriffe mehr als im Jahr davor. Prof Kuck: „Derzeit
erhalten in Deutschland mehr Männer als Frauen
Schrittmacher/ICD-Systeme.
- Die Morbidität der Herzrhythmusstörungen ist
allerdings bei Frauen größer als bei Männern, sodass der große
Geschlechterunterschied nicht plausibel ist.“
Obwohl die Neuimplantationsrate pro Million Einwohner in Deutschland
etwas höher ist als etwa in Schweden oder der Schweiz, kann von einer
Überbehandlung nicht die Rede sein:
„Die Leitlinientreue bei der
Indikationsstellung liegt sowohl bei den Herzschrittmachern als auch bei
den ICD bei mehr als 90 Prozent.
Bei der Auswahl der Systeme wurde in
97,5 Prozent der Schrittmacher und 95,1 Prozent der ICD die Leitlinien
berücksichtigt“, so der DGK-Präsident.
„Die Qualität der Versorgung mit
kardialen Rhythmusimplantaten hat in Deutschland weiterhin ein hohes
Niveau und kann sich mit den beiden europäischen Nachbarn, die
belastbare Daten generieren, durchaus messen.“
Katheter-gestützte Herzklappen-Implantation immer häufiger und sicherer
Bei den Herzklappenerkrankungen ist von 1995 bis 2013 insgesamt ein
Anstieg der stationären Morbiditätsziffer von 69 auf 107 feststellbar,
was einem Plus von 55,4 Prozent entspricht.
Prof. Kuck:
„Wahrscheinlichste Ursache für die Entwicklung ist die höhere
Lebenserwartung insgesamt und die verbesserte Diagnostik bei diesen
Erkrankungen.“ In der Altersgruppe der ab 75-Jährigen war eine besonders
hohe Zunahme der stationären Morbiditätsziffer um 153,4 Prozent von 224
auf 568 pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen, diesem Anstieg steht ein
Rückgang in den meisten anderen Altersgruppen gegenüber.
- In der Therapie gibt es seit einiger Zeit, in Ergänzung der
Klappenchirurgie mit Klappenersatz oder Klappenrekonstruktion, die
Möglichkeit, mittels Gefäßkatheter über verschiedene Zugangswege die
Aortenklappe zu ersetzen (Katheter-gestützter perkutaner
Aortenklappenersatz, TAVI). Auch die Behandlung der undichten
Mitralklappe mittels Kathetertechnik ist heute möglich.
Inzwischen wird TAVI nicht mehr nur bei ausgesprochenen Risikopatienten,
sondern auch schon bei mittlerem Risiko als Alternative zum
herzchirurgischen Klappenersatz durchgeführt – und das mit sehr guten
Ergebnissen.
Laut aktuellen Registerdaten der verpflichtenden
Qualitätssicherung AQUA hat TAVI auch bei Patienten mit mittlerem Risiko
ein niedrigeres Sterblichkeitsrisiko als die konventionelle
chirurgische Operation.
Ob TAVI bei Patienten mit mittlerem Risiko
generell empfohlen werden kann, wird gegenwärtig in großen
randomisierten Studien geprüft.
2013 wurden in Deutschland erstmals mehr TAVI als chirurgische Klappen
implantiert.
Gemäß AQUA-Report beträgt die Sterblichkeit im Krankenhaus
nach dem Eingriff insgesamt 6,5 Prozent, was jedoch Patienten aller
Risikostufen einschließt.
Die Auswertung zeigt, dass das Sterberisiko
unmittelbar nach einer herzchirurgisch implantierten Klappe nur bei
Patienten mit sehr niedrigem Operationsrisiko etwas geringer ist als
nach einer transvaskulären, über die großen Blutgefäße erfolgenden
TAVI-Implantation, obwohl die TAVI-Patienten im Durchschnitt rund 12
Jahre älter sind.
In allen anderen Risikogruppen schneiden
transvaskuläre TAVI Patienten am besten im Vergleich zu transapikalen
und diese wiederum besser als herkömmlich chirurgische Patienten ab.
Umfassende Prävention konsequent ausbauen
Der Herzbericht zeigt auch gravierende Unterschiede in der
Herzgesundheit zwischen den Bundesländern auf,
wobei Sachsen-Anhalt
besonders negativ abschneidet.
Es nimmt seit Jahren eine Spitzenposition
in der Sterblichkeitsstatistik der ischämischen, durch verminderten
Blutfluss bedingten Herzkrankheiten ein. Sachsen-Anhalt ist hinsichtlich
sozialer Faktoren (Anteil an Schulabgängern ohne Abschluss, niedriger
Anteil von Personen mit (Fach-) Hochschulreife, hohe Arbeitslosigkeit,
etc.) in einer sehr ungünstigen Lage.
Solche Faktoren sind Studien
zufolge Determinanten von Lebensstilfaktoren und damit auch von
Risikofaktoren der ischämischen Herzkrankheit. Die Häufigkeit des
Rauchens, von Übergewicht und Fettleibigkeit, des Diabetes mellitus,
depressiver Symptome, diagnostizierter Depressionen und sportliche
Inaktivität sind bei Menschen mit niedrigem Sozialstatus deutlich
erhöht.
„Hier liegen präventive Ansatzmöglichkeiten zur Senkung der
Sterblichkeit der ischämischen Herzkrankheit“, so Prof. Kuck. „Zu
wünschen ist, dass eine verbesserte Diagnostik von Menschen mit
Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörungen, sowie eine
konsequente Behandlung der neu entdeckten Diagnosen zu einer weiteren
Reduktion der Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt.“
Bekannt ist ebenfalls, dass bei einem großen Prozentsatz von Patienten
mit bekannter und behandelter arterieller Hypertonie keine optimale
Blutdruckeinstellung gelungen ist. Prof. Kuck: „Auch hier besteht ein
sinnvoller Ansatz zur kardiovaskulären Prävention von Morbidität und
Mortalität.“
Neben dem klinisch-präventiven Ansatz sei ein
gesellschaftlich-politischer Ansatz im Sinne einer Verhältnisprävention
zu bedenken.
Hierzu gehören eine Verschärfung des
Nichtraucherschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sowie vor allem
politische Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit und geringe Bildung.
„Soziale Faktoren lassen sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam
politisch beeinflussen“, so der DGK-Präsident.
„Daher sind
Präventionsmaßnahmen dringend angezeigt, die das individuelle Verhalten
günstig beeinflussen, und Maßnahmen, die zu einer optimalen Behandlung
entdeckter und aufzudeckender Hypertoniker, Diabetiker und Patienten mit
gestörtem Fettstoffwechsel führen.“
Männer erkranken weit häufiger an den verbreitetsten Herzkrankheiten als
Frauen, allerdings ist die Sterblichkeit bei Frauen insgesamt deutlich
höher, heißt es im aktuellen Deutschen Herzbericht, der heute in Berlin
vorgestellt wurde.
„Frauen mit Herzklappenkrankheiten,
Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz scheinen eine ungünstigere
Prognose zu haben als Männer mit diesen Erkrankungen.
Beim akuten
Herzinfarkt und bei ischämischen, durch Minderdurchblutung begründeten
Herzkrankheiten hingegen haben Männer eine schlechtere Prognose als
Frauen“, so Prof. Dr. Karl-Heinz Kuck (Hamburg), Präsident der DGK.
Herzkrankheiten machten in Deutschland 8,3 Prozent (1.595.312) aller im
Rahmen der Krankenhausdiagnosestatistik erfassten stationären Fälle
(Morbiditätsziffer) aus.
Von den im aktuellen Deutschen Herzbericht
erfassten kardiologischen Diagnosen betreffen 57,8 Prozent Männer und
42,2 Prozent Frauen (2013).
Am Geschlechterverhältnis hat sich damit im
Vergleich zum Vorjahr nichts geändert.
Die Erkrankungshäufigkeit betrug
2013 bei Männern 2.330,6 auf 100.000 Einwohner und bei Frauen 1.634.
• Bei
ischämischen, also durch Minderdurchblutung hervorgerufenen
Herzkrankheiten ist die Zahl der betroffenen Männer mit 1.107,6 (auf
100.000 Einwohner) mehr als doppelt so groß wie die der Frauen (518,7).
• Beim
akuten Herzinfarkt (Myokardinfarkt) ist die Zahl der betroffenen
Männer mit 365,2 doppelt so groß wie die der Frauen (185,8).
• Bei
Herzklappenkrankheiten beträgt die Zahl der Männer 118,1 und für
Frauen 96,1. Der Wert für Männer liegt damit um 22,9 Prozent über dem
für Frauen.
• Bei
Herzrhythmusstörungen übersteigt die Zahl der Männer mit 587,1 jene für Frauen (502,5) um 16,8 Prozent.
• Bei
angeborenen Fehlbildungen des Kreislaufsystems liegt die Zahl der
männlichen Patienten mit 28,6 um 16,7 Prozent über jener der weiblichen
Patienten (24,5).
• Die Herzinsuffizienz (Herzschwäche) ist unverändert die einzige
Herzkrankheit, bei der die Zahl der davon betroffenen Männer (489,3)
unter jener der Frauen (492,2) liegt: Differenz 0,6 Prozent.
Wie in den Vorjahren ist allerdings die Sterblichkeit bei Frauen in der
Summe aller ausgewählten Diagnosen deutlich höher als bei Männern.
- Von
den Patienten, die an einer der im Deutschen Herzbericht dargestellten
häufigsten Herzkrankheiten gestorben sind, sind 45,9 Prozent Männer und
54,1 Prozent Frauen.
Die Sterbeziffer beträgt insgesamt 268,9 auf
100.000 Einwohner, bei Männern 252 und bei Frauen 285,2.
• Bei den ischämischen Herzkrankheiten übersteigt die Sterbeziffer bei Männern mit 169,8 die bei Frauen mit 149,6.
• Beim akuten Herzinfarkt ist die Sterbeziffer bei Frauen mit 55,9 um
23,7 Prozent niedriger als bei Männern (73,3). Ein ähnlich starker
Unterschied zwischen den Sterbeziffern von Männern und Frauen fand sich
auch in den Vorjahren. Prof. Kuck: „
Somit scheinen Männer beim akuten
Herzinfarkt eine ungünstigere Prognose zu haben als Frauen.“
• Die Sterbeziffer der Herzklappenkrankheiten beträgt bei Männern 15,3
und bei Frauen 23,9. Der Wert bei Frauen liegt somit um 56,2 Prozent
höher. Prof. Kuck: „Dieser Unterschied ist unerwartet groß.“
• Die Sterbeziffer der Herzrhythmusstörungen übersteigt bei Frauen
(38,5) die der Männer (26,2) um 47 Prozent. „Dieser Unterschied verläuft
zuungunsten der Frauen, ist unerwartet groß und nicht ohne weiteres
erklärlich“, kommentiert Prof. Kuck die Ergebnisse.
• Die Sterbeziffer der Herzinsuffizienz beträgt bei Männern 40 und bei
Frauen 72,7. Der Wert der Frauen liegt somit 81,6 Prozent über dem der
Männer. Prof. Kuck: „Auch dieser Unterschied ist unerwartet groß und
nicht ohne weiteres erklärlich.“
• Die Sterbeziffer der angeborenen Fehlbildungen des Kreislaufsystems
beträgt insgesamt 0,6 und ist bei beiden Geschlechtern ähnlich niedrig.
„Der Anstieg der Sterblichkeit ist bei verschiedenen Diagnosen mit
zunehmendem Lebensalter unterschiedlich“, so Prof. Kuck.
Bei Männern
nimmt die Sterblichkeit an Koronarer Herzkrankheit ab dem 65. bis 70.
Lebensjahr zu, dagegen steigt die Sterblichkeit bei den übrigen
Diagnosen erst ab dem 75. bis 80. Lebensjahr an.
Auffällig ist bei
Männern der deutliche Anstieg der Sterblichkeit an der Herzinsuffizienz
ab dem 80. bis 85. Lebensjahr.
„Bei Frauen nimmt die Sterblichkeit an
der Koronaren Herzkrankheit erst ab dem 75. bis 80. Lebensjahr
exponentiell zu, gleiches gilt für die Sterblichkeit an einer
Herzinsuffizienz ab dem 80. bis 85. Lebensjahr“, so der DGK-Präsident.
Ein wesentlicher Faktor für die Zunahme der Mortalität ist sicher die
verbesserte Lebenserwartung der Patienten, die bei der Berechnung der
Morbiditäts- und Mortalitätsdaten nicht berücksichtigt ist.
Medizin am Abend Berlin DirektKontakt:
www.medizin-am-abend.blogspot.com
Über Google: Medizin am Abend Berlin
Prof. Dr. Eckart Fleck (Pressesprecher DGK); presse@dgk.org
Hauptstadtbüro der DGK, L. Nawrocki , Tel.: +49 30 206 44482
Geschäftsstelle der DGK, Pressebüro K. Krug; Tel.: +49 211 600 69243
Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz und Kreislaufforschung
e.V. (DGK) mit Sitz in Düsseldorf ist eine gemeinnützige
wissenschaftlich medizinische Fachgesellschaft mit heute mehr als 9400
Mitgliedern. Ihr Ziel ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet
der kardiovaskulären Erkrankungen, die Ausrichtung von Tagungen und die
Aus-, Weiter- und Fortbildung ihrer Mitglieder. 1927 in Bad Nauheim
gegründet, ist die DGK die älteste kardiologische Gesellschaft in
Europa. Weitere Informationen unter www.dgk.org
Weitere Informationen für international Medizin am Abend Beteiligte
http://www.dgk.org
http://www.kardiologie.org